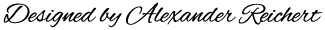Erlebnisse
Vorwort
Die Seite enthält bisher acht Begebenheiten. Weitere werden folgen, sobald ich die Zeit dafür finde. Stoff ist genügend vorhanden. Bitte haben Sie Geduld mit mir. Die Begebenheiten auf dieser Seite sind nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Da die meisten aber zig Jahre zurückliegen, können sie mitunter Fehler enthalten, die ich zu entschuldigen bitte. In keinem Fall steckt aber Absicht dahinter.
Register
- Der 24. Dezember
- Das ist ja nochmal gut gegangen
- Die Wahrsagerin
- Wer weiß, wofür es gut ist?
- Der Schokoladen-Onkel
- Wie Phönix aus der Asche - Eindrücke aus der Nachkriegszeit
- David gegen Goliath - Dramaturgie eines Machtkampfs
- Die Versorgungslücke
Der 24. Dezember
Ein Jahr hat 365 Tage. Von keinem geht aber so viel Faszination aus, wie vom 24. Dezember: Heiligabend. Zumindest in unserem christlichen Kulturkreis. An keinem anderen Tag sind die Kirchen so voll, für keinen anderen Tag wird so viel Geld ausgegeben, um keinen anderen Tag ranken sich so viele Geschichten, an keinem anderen Tag werden so viele Menschen melancholisch, nachsichtig und mildtätig.
Dass es mit diesem Tag etwas Besonderes auf sich haben musste, wurde mir schon als kleines Kind klar, weil mein Vater an diesem Abend seinen schwarzen Anzug trug. Ausgerechnet mein Vater, der ansonsten abends zu Hause mit Schlafanzug und Morgenmantel rumlief und auch nicht durch Frömmigkeit auffiel. Der schwarze Anzug war auch bestimmt kein angenehmes Kleidungsstück angesichts der zusätzlichen Pfunde, für die das leckere Essen an Weihnachten stets sorgte. Und mein Vater war kein Kostverächter …
Was mir aber noch viel mehr das Besondere dieses 24. Dezembers deutlich machte, war eine Erzählung meines Vaters, der im Krieg Stalingrad erlebte, Gott sei Dank überlebte und zu berichten wusste, dass die Kampfhandlungen Heiligabend auf beiden Seiten ruhten. Bei Niederschrift dieser Zeilen habe ich vergeblich versucht, diese Erzählung mittels Google zu verifizieren. Sie kann stimmen, muss es aber nicht. Wie dem auch sei, mich als Kind hat die Erzählung sehr beeindruckt.
Heiligabend war für uns das Höchste und ich freute mich schon bald nach Weihnachten auf den nächsten Heiligen Abend. Genau so erging es auch meiner späteren Frau. Als wir uns kennen lernten, hatte sie große Sehnsucht nach harmonischen Weihnachten, die sie von zu Hause nicht kannte. Ein Pluspunkt für mich bei ihrer Partnerwahl. Ihre Sehnsucht nach Weihnachten war so groß, dass unser Aufwand dafür von Jahr zu Jahr immer größer und von mir zunehmend kritisch hinterfragt wurde, was sie traurig machte. Wie vertrug sich das mit meiner Angewohnheit, an jedem 24. eines Monats die Familie zu fragen, ob sie denn wisse, was heute für ein besonderer Tag sei: „Heute in x Monaten ist wieder Heiligabend …“
Unvergessen unser trauriger, letzter gemeinsamer 24. Dezember: 2014. Kurz zuvor hatte meine Frau ihre tödliche Diagnose erhalten: Krebs mit Metastasen im fortgeschrittenen Stadium, Operation zwecklos. Die Ärzte drängten sie zum sofortigen Beginn der Chemotherapie, ließen dann aber meine Frau auf ihren ausdrücklichen Wunsch nach Hause, um mit uns Weihachten zu feiern. Ein letztes Mal. Beim Stille-Nacht-Singen versagte mir die Stimme; Musik und Chor der CD überspielten es.
Und heute? Fünf Jahre nach dem letzten gemeinsamen 24. Dezember feiere ich mit unserem erwachsenen Sohn Alexander in bescheidenerem Rahmen in derselben Wohnung Weihnachten, in der wir zu Dritt gewohnt haben. Ein kleiner, künstlicher Weihnachtsbaum, der früher als Zweitbaum in seinem Zimmer stand, steht jetzt im Wohnzimmer, von ihm jedes Jahr liebevoll geschmückt. Die beleuchtete Krippe mit Porzellanfiguren und den wichtigsten adventlich-weihnachtlichen Schmuck haben wir behalten, anderen verschenkt. So lange mir das alters- und gesundheitsbedingt möglich ist, steht Weihnachten eine kleine Nordmanntanne mit Wurzelballen auf dem Grab meiner Frau, weihnachtlich geschmückt und mit Batterien elektrisch beleuchtet. Und am späten Heiligen Abend, wenn alles dunkel ist und auf dem Friedhof hunderte Kerzen auf den Gräbern brennen, besuchen wir jedes Jahr das Grab meiner Frau und Alexanders Mutter. Jedes Jahr ein sehr berührendes Erlebnis. Sie hätte es sich bestimmt so gewünscht.
Das ist ja nochmal gut gegangen
Um sich eines Tages, wie in meinem Fall, dem 80. Lebensjahr nähern zu können, ist es notwendig, lebensgefährliche Situationen überstanden zu haben, seien sie krankheits- oder unfallbedingt. Hier einige Beispiele, woran ich mich unter dem Resümee „Das ist ja nochmal gut gegangen“ erinnern kann:
Mein Leben hätte schon im zarten Alter von 3 ½ Jahren zu Ende sein können. Da lag ich nämlich mit Kinderlähmung in der Kölner Universitätskinderklinik, umgangssprachlich „der Lindenburg“ genannt. Es war Oktober 1943 und bekanntlich Krieg. Auch wenn sich Kinder erfahrungsgemäß selten so weit zurück erinnern können: Ich kann es. Dafür waren die Ereignisse zu einprägsam. Wegen Ansteckungsgefahr durften meine Angehörigen nicht zu mir. Wegen Bombenalarm lag ich alleine in einem schwach beleuchteten Kellerraum. Statt eines Kellerfensters gab es nur ein kleines Luftloch, vor dem zum Druckausgleich eine oben befestigte Stahlplatte hing. Bei jedem Bombentreffer in der Nähe wurde das Gebäude nicht nur wie bei einem Erdbeben erschüttert, sondern auch für einen kurzen Moment angehoben. Bei jeder Detonation wurde auch die Stahlplatte vor dem Fensterloch angehoben; scheppernd fiel sie dann wieder zurück. Bis zum Volltreffer auf das eigene Gebäude. Da setzt dann auch meine Erinnerung aus. Ich weiß nur, dass ich anschließend in einen großen, hohen Raum gebracht wurde, in dem viele andere Kinder lagen und soweit möglich, auf ihre Abholung durch Angehörige warteten. Auf dem Weg dorthin hörte ich vom Pflegepersonal, dass in meiner Nähe fünf Kinder ums Leben gekommen waren, ich also ausgesprochenes Glück hatte.
Viele Jahre später wurde mir wieder mal mein Glück bewusst, was ich gerade gehabt habe. Ich war mit meiner Frau auf der Autobahn unterwegs, als sich ein Zwillingsreifen von einem LKW auf der Gegenfahrbahn löste, durch die Luft geschleudert wurde und einen PKW auf der Überholspur unserer Fahrtrichtung kurz vor uns traf. Der Unfallwagen rollte auf der Überholspur langsam aus, kam schließlich zum Stehen. Ich fuhr unseren Wagen rechts ran und ging zum Unglückwagen rüber um zu sehen, ob dort noch Hilfe möglich ist. Die nachfolgenden Wagen waren inzwischen auch zum Stehen gekommen, so dass ich gefahrlos zu dem Unglückswagen rübergehen konnte. Der Zwillingsreifen hatte das Dach des Unglückswagens abgerissen und den Schädel des Fahrers zertrümmert. Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr ein so schreckliches Bild gesehen. Es hätte auch uns treffen können. Ich signalisierte dem nachfolgenden Verkehr, dass da nichts mehr zu machen ist, und wollte an der nächsten Notrufsäule Hilfe herbeirufen. Handys bzw. Smartphones gab es nämlich damals noch nicht, damit auch nicht die Möglichkeit, damit Fotos zu machen, damit auch nicht das heutige Phänomen unfallfotografierender Gaffer. An der Notrufsäule stand aber schon ein anderer Fahrer, der offensichtlich vor uns bereits den Unfall mitbekommen hatte.
Dreimal haben starke Schneefälle eine Gefahr dargestellt. Das erste Mal war ich mit meiner Frau nach einem Facharztbesuch abends auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Nürnberg, als wir vor Würzburg von außergewöhnlich starkem Schneefall überrascht wurden. Dieser war so stark, dass immer mehr Fahrzeuge die Parkplätze anfuhren, um auf den Räumdienst zu warten. Dies tat ich zunächst auch. Bald wurde mir aber klar, dass ich mit meiner kranken Frau an Bord diese Option nicht hatte und wieder auf die Autobahn fuhr. Ich hatte Glück, dass gerade vor mir ein Lastzug ebenfalls den Mut hatte weiterzufahren und uns damit den Weg ebnete.
Das zweite Mal war ich nach starkem Schneefall mit Kollegen und meinem Chef auf der Fahrt von unserem Werk in Nürnberg zu unserem Zweigwerk in Berching/ Oberpfalz. Auf einer relativ schmalen Straße, die durch den Wald verlief, kam uns ein LKW entgegen, der mich durch seine Breite zwang, auszuweichen und dafür die von mir genutzte Fahrspur eines vor mir gefahrenen LKWs zu verlassen. Dadurch kam ich ins Schleudern, hatte aber das Glück, mich nach dem Ausweichmanöver wieder in der bis dahin genutzten Fahrspur fangen zu können. Meinen Beifahrern war auch ganz mulmig zumute, wie sie anschließend gestanden. Sie hätten sich in Gedanken schon in irgendeinem Graben liegen gesehen.
Das dritte Mal wurde ich von extrem starkem Schnellfall im März (!) auf der Autobahn Lübeck-Hamburg überrascht. Der Schneefall war so stark und der Schnee so nass, dass die Scheibenwischer damit nicht mehr zurechtkamen. Hinzu kam, dass die nassen Schneemassen auf dem Wagendach teils auf die Windschutzscheibe und teils auf die Heckscheibe rutschten und die Aussicht versperrten. Dadurch schaffte ich es ein kurzen Moment lang nicht mehr, mich in Fahrspur vor mir fahrender LKWs zu halten. Ich kam ins Schleudern, der Wagen drehte sich um 180° und blieb entgegen der Fahrtrichtung an einem 50 m-Pfosten stehen. Dieser Pfosten verhinderte, dass der Wagen in einen Graben entlang der Autobahn rutschte. Erfreulicherweise hielten mehrere Fahrer und boten mir Hilfe an, u.a. ein Polizist in Zivil auf dem Weg zur Arbeit. Leider sperrte die herbeigerufene Autobahnpolizei nur die rechte Fahrspur ab, damit ich wenden konnte. Das ist verdammt knapp, um den Wagen um 180° drehen zu können, während auf der Überholspur der Verkehr floss. Wie ich dann erfuhr, wurde bereits im Verkehrsfunk vor einem Falschfahrer auf der Autobahn Hamburg-Lübeck in Fahrtrichtung Hamburg gewarnt. Schließlich stand ich ja mit voller Beleuchtung entgegen der Fahrtrichtung. Wie es dazu kam, konnten die Fahrer nicht wissen, die den Verkehrsfunk informiert hatten. Inzwischen gab es Handys.
Mit Nebel auf der Autobahn konnte ich in der Regel gut umgehen. Aber keine Regel ohne Ausnahme: Ich war mit meiner Familie abends im Dunkeln auf der Rückfahrt aus dem Raum Hannover zu unserem damaligen Wohnort Nürnberg. Am Biebelrieder Dreieck, der Kreuzung von A3 und A7, herrschte dichter Nebel.
Nebel hat u.a. die unangenehme Eigenschaft, dass man die eigene Fahrgeschwindigkeit schlecht abschätzen kann, weil man den Bezug zur Landschaft verliert und wegen gebanntem Blick nach vorne aus dem Fenster zu selten auf den Tacho schaut. Damit habe ich die Abfahrt in Richtung Nürnberg zu spät gesehen und den Wagen bei ca. 80 km/h zu scharf nach links gerissen. Infolge dessen verlor der Wagen kurzzeitig die Bodenhaftung und fuhr nur noch auf den beiden linken Rädern. Gott sei Dank gelang es mir aber, den Wagen wieder zu stabilisieren und Nürnberg heil zu erreichen. Ansonsten hätte sich nämlich meine berufliche Zukunft, derentwegen wir im Raum Hannover waren, erübrigt. Dass ich in dieser Situation nicht einfach eine Abfahrt weitergefahren bin und dort gewendet habe, hatte übrigens den einfachen Grund, dass das damals noch gar nicht möglich war. Die Strecke geradeaus über Ulm bis Füssen war nämlich noch im Bau. Wäre ich in die Baustelle des späteren Autobahnkreuzes gefahren, hätte ich bei Nebel keine Chance mehr gehabt, dort wieder herauszukommen. Das war mir bei meinem Fehlverhalten bewusst.
Neben Schnee und Nebel geriet ich noch mit einer weiteren Naturgewalt in Konflikt: dem Sturm. Ich war in Hamburg gerade auf der Elbchaussee stadtauswärts unterwegs, als nach Passieren des Altonaer Rathauses eine Sturmbö ein vorübergehend am Straßenrand aufgestelltes Verkehrsschild erfasste und auf meinen Wagen schleuderte. Dank der stromlinienartigen Bauweise des Wagens rutschte es von der Motorhaube über die Windschutzscheibe und fiel hinter dem Wagen auf die Straße. Dank eines meteorologischen Gutachtens, wonach zur fraglichen Zeit Windböen bis zur Windstärke 8 möglich waren, erstattete mir später das Bezirksamt Altona den Schaden. Augenzeugen gab es nämlich keine. Glück im Unglück: Wäre das Verkehrsschild nicht über meinen Wagen gerutscht, sondern hätte die Windschutzscheibe zertrümmert, hätte mich der Mast des Schildes durchbohren oder das eigentliche Schild köpfen können …
Als guter Arbeitnehmer habe ich mir das Kranksein fürs Alter aufgehoben, aber auch dabei wieder viel Glück im Unglück gehabt. Wir wohnten damals in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Pforzheim, als ich unseren Hausarzt wegen chronischer Müdigkeit aufsuchte. Als Grund dafür machte er mit einer Blutuntersuchung Vitamin B12-Mangel aus; als Nebenbefund stellte er aber einen hohen PSA-Wert fest, ein Indiz, dass mit der Prostata etwas nicht stimmt.
Das bestätigte dann anschließend auch der Urologe, konnte den Grund dafür aber lange Zeit nicht finden. Dafür ist die Aussagekraft des PSA-Wertes in Fachkreisen zu umstritten, als dass rein aufgrund eines hohen PSA-Wertes schon ein Chirurg zum Messer greift. So habe ich mich wiederholt schmerzhaften Gewebeentnahmen unterziehen müssen, bis der behandelnde Urologe und sein Kollege, die diese Prozedur stets gemeinsam durchführten, endlich Krebszellen fanden und alles weitere veranlassten. Der Chefarzt der urologischen Abteilung des Klinikums Pforzheim lobte nach der Operation und anschließender pathologischer Befundung seine niedergelassenen Kollegen, dass sie den räumlich so kleinen, dafür aber umso aggressiveren Bereich von Krebszellen geortet hätten. Er sei aber zuversichtlich, dass sie mit der Entfernung der Prostata und vorangegangener Entfernung der wichtigsten Lymphknoten alles krankhafte Gewebe entfernt hätten.
Dem war aber leider nicht so, denn schon anderthalb Jahre später stieg der PSA-Wert wieder an. Ich habe sogar abends nach seiner Sprechstunde noch mit meinem Urologen darüber diskutiert, ob man bei einem so geringen Wert schon von einem Rückfall sprechen könne. Er war aber überzeugt, dass der PSA-Wert ohne Prostata 0,0 sein müsse. Das war er aber nicht mehr. Und so bedurfte es noch einer Serie von Bestrahlungen, bis ich dann endlich Ruhe hatte.
Die Quintessenz: Hätte ich auf meine Frau gehört, die es gut mit mir meinte und mir weitere schmerzhafte Probeentnahmen ersparen wollte, da käme doch eh nichts bei raus, und wäre ich nicht der Logik meines Urologen gefolgt, wo Rauch ist, da müsse auch ein Feuer sein, gäbe es mich heute nicht mehr. Denn im Gegensatz zur Prostatavergrößerung als Alt-Männer-Krankheit mit der bekannten Schwierigkeit beim Wasserlassen treten die Beschwerden bei Krebs erst spät auf. Dann ist es oftmals zu spät. Und ohne exakte Befundung hätte sich auch kein seriöser Chirurg gefunden, der zum Messer gegriffen hätte.
Die Wahrsagerin
Es waren gesundheitliche Gründe bei meiner Frau, die uns am Anfang unserer Ehe zu einer Wahrsagerin führten. Meine Schwiegermutter kannte sie von früher. In einer Zeit, als es den Begriff „political correctness“ noch nicht gab, es damit zumindest nicht so weit her war, sprach man noch von einer Zigeunerin. Sie las vorwiegend aus der Hand, galt als gut, wenn sie „gut drauf war“. Das richtig einzuschätzen, war für ihre Klienten das wichtigste. Es war unklug, sie zu einer Aussage zu drängen, nur weil man selbst unter Druck stand. Wenn sie aber „gut drauf war“, gab sie mitunter schon in der „Warmlaufphase“ Erstaunliches von sich, basierend auf guter Menschenkenntnis und gesammelter Lebenserfahrung.
Ich muss gestehen, dass ich mich als Naturwissenschaftler anfangs schwer damit tat, so jemanden aufzusuchen und das Gesagte ernst zu nehmen. Aber wie sagte schon William Shakespeare? „Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.“ Wahrsager, Hellseher, Astrologen bzw. Sterndeuter begleiten die Menschheitsgeschichte seit Urzeiten. Und wie ich jüngst bei einem ungeklärten Kriminalfall gelesen habe, vertraut sich ihnen mitunter sogar die Kriminalpolizei an, wenn die Hinweise aus der Bevölkerung abgearbeitet sind und zu keinem Ergebnis geführt haben.
Zwar konnte sie uns bei unserem eigentlichen Anliegen nicht weiterhelfen. Aber zwei andere Aussagen sind bei mir haften geblieben: „Sie werden mal viel mit Papier zu tun haben.“Ein sibyllinisches Orakel, dessen Interpretation nicht auf der Hand lag. Welchen Streit hat es im antiken Griechenland um die richtige Auslegung des Orakels von Delphi gegeben, sich „hinter hölzernen Mauern“ gegen die anrückenden Perser zu verteidigen? Was mich aber anbetrifft, so habe ich rückblickend in der Tat in meinem Leben unsagbar viel zu Papier gebracht, Veröffentlichtes und nicht Veröffentlichtes. Man könnte mich als „kommunikativ“ bezeichnen. Wo andere kaum den Mund aufmachen, erhaltene E-Mails entweder gar nicht beantworten oder nur mit einem knappen Satz, neige ich dazu, ein Thema so ausführlich abzuhandeln, dass keine Frage mehr offenbleibt.
Vor der zweiten Prophezeiung stutzte sie einen Moment, schüttelte den Kopf und sagte dann: „Nein – das mit der Politik kommt später“. Und wie recht sie hatte. Ich war zwar mein ganzes Leben lang politisch sehr interessiert, bin aber erst mit 53 Jahren politisch tätig geworden, das dann aber umso intensiver.
Wer weiß, wofür es gut ist?
Mitunter dauert es Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis man erkennt oder sich eingesteht, dass eine große erlittene Enttäuschung, ein herber Verlust, auch seine positiven Seiten haben kann. So muss ein Ende nicht hoffnungslos sein, sondern als Chance für etwas Neues gesehen werden, zu dem es ansonsten nicht gekommen wäre. Drei Beispiele aus meinem Leben:
Wie Sie vielleicht schon gelesen haben , habe ich mich in Köln jahrelang intensiv mit der Beobachtung der Funksignale künstlicher Erdsatelliten beschäftigt. Um die aus eigener Initiative entstandene und mit eigenen Mitteln finanzierte Tätigkeit fortsetzen zu können, brauchte ich unbedingt Geld, habe es aber weder von der Stadt Köln noch vom Landesforschungsamt Nordrhein-Westfalen bekommen, von einem kleinen einmaligen Betrag der Stadt mal abgesehen. Zu meiner großen Enttäuschung musste ich daher die Tätigkeit aufgeben. Heute weiß ich: Wie gut, dass es dazu kam. Und das in mehrfacher Hinsicht. Eigentlich hätte mir nämlich schon damals klar sein müssen, dass meine Aktivität, so berechtigt sie zu ihrer Zeit war, vom wissenschaftlichen Nutzen, dem öffentlichen Interesse und auch vom eigenen beruflichen und privaten Interesse her keine Zukunft gehabt hätte. Nun war ich frei und konnte meine ureigensten Ziele verfolgen. So lernte ich schon während des Auslaufens der Satellitenbeobachtung meine Frau kennen, habe bald geheiratet, meine Ausbildung beendet und meine erste Stellung in der Industrie angetreten. All das wäre mir ansonsten nicht möglich gewesen.
Wie Sie vielleicht ebenfalls schon gelesen haben , hat unser Sohn Alexander infolge einer schweren Erkrankung in jungen Jahren erst spät den Einstieg ins Berufsleben geschafft. Unter seinen gesundheitlichen Rahmenbedingungen war das auch nur als Selbstständiger möglich. Die freudige Nachricht, dass er jetzt auch seinen zweiten Fernkurs mit „Sehr gut“ absolviert hat und damit für eine Tätigkeit als Grafik- und Webdesigner gut gerüstet war, konnte er seiner Mutter noch kurz vor ihrem Tod überbringen. Wir vermissen sie beide sehr, wissen zu schätzen, was wir an ihr hatten, und besuchen ihr Grab, so oft wir können. Wir müssen aber auch eingestehen, dass Mutter und Sohn zusammen keine Zukunft gehabt hätten. Unsere Wohnung wäre von Größe und Zuschnitt für eine selbstständige berufliche Tätigkeit nicht geeignet gewesen. Und für unseren Sohn gewerbliche Räume anzumieten, hätte ich als Rentner nicht das Geld gehabt. Durch den Tod meiner Frau konnte ich ihm das relativ große Elternschlafzimmer für seine Arbeit zur Verfügung stellen. Das Mobiliar haben wir verkauft und ich nächtige seither auf einer Studioliege in einer Nische unseres Wohnzimmers. Da ich meinem Sohn bei seiner Arbeit so gut ich kann helfe, bestimmen berufliche Themen unsere Unterhaltung. Privatleben findet kaum statt, für Jungunternehmer eher die Regel. Auch aus diesem Grund wären die Interessen meiner Frau zu kurz gekommen.
Und noch ein drittes Beispiel: Wie Sie vielleicht schon meiner Seite „Politik“ entnommen haben, wurde ich im Herbst 1998 als Abgeordneter von STATT Partei in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt. Da sich die Bürgerschaft als so genanntes Feierabendparlament versteht, konnte ich diese Tätigkeit neben meiner beruflichen Tätigkeit bei der Deutschen Aerospace (DASA) wahrnehmen. Als wir aber innerhalb unserer Fraktion mit Statt Partei Gründer und Fraktionsvorsitzendem Markus Wegner immer weniger zurechtkamen, stellte sich die Frage nach Alternativen. Nachdem ich als Folge des Sanierungskonzeptes „Dolores“ Ende 1994 zusammen mit 16.000 Kollegen meinen Arbeitsplatz bei DASA verlor und mich anschließend selbstständig machen wollte, war ich für unsere Fraktion eine mögliche Alternative und dankbar für das gewonnene Vertrauen. Ohne Verlust meines Arbeitsplatzes oder nach Aufnahme meiner selbstständigen Tätigkeit wäre die zeitintensive und aufreibende Arbeit als Fraktionsvorsitzender nicht möglich gewesen.
Der Schokoladen-Onkel
Meine Großmutter mütterlicherseits war eine geborene Imhoff, Tochter eines Schlossermeisters aus Köln. Sie war eines von 7 Kindern, fünf Mädchen und zwei Buben. Kinderreichtum war damals keine Seltenheit. Fritz, einer der beiden Buben, starb früh; ich habe ihn nicht mehr kennengelernt. Bei Charlotte aber, seiner Frau, kurz Tante Lotte genannt, habe ich mal ein paar Tage meiner großen Schulferien verbracht – in Bullay an der Mosel. Das wäre nicht der Rede wert, wenn sie nicht einen Sohn gehabt hätte, der es aus bescheidensten Ansätzen heraus in seinem Leben weit gebracht hat.
Ich muss damals wohl so um die 14 Jahre alt gewesen sein, eher weniger als mehr. Tante Lottes bescheidener Wohnung gegenüber lag die Schokoladenfabrik ihres Sohnes Hans. Es war für mich schon spannend, vom Fenster aus dem Treiben dort drüben zuzuschauen. Insbesondere der Morgenappell um 9 Uhr, wenn sich nach dem Heulen der Werkssirene die vorwiegend weiblichen Mitarbeiter mit ihren weißen Kitteln und Häubchen wie auf einem Kasernenhof in Reih und Glied aufstellten.
Einmal durfte ich aber auch alles aus nächster Nähe kennenlernen. Onkel Hans lud mich nämlich in sein Büro ein, von wo aus er alles im Griff hatte. Mit seinen engsten Mitarbeitern konnte er jederzeit auf Tastendruck in Sprechkontakt treten - betriebliche Mitbestimmung und Datenschutz gab es damals noch nicht … Und von einem seiner engsten Mitarbeiter ließ er mir dann auf Zuruf seinen Betrieb zeigen. Während heutzutage junge Menschen schon erfreulicherweise früh Industriebetriebe kennenlernen – für mich war es damals völlig neu und faszinierend zu sehen, wie beispielsweise Pralinen weder von Hand aus ihrer Form genommen noch eingepackt werden, sondern wie das alles vollautomatisch in großem Tempo geschieht. Onkel Hans betrieb aber nicht nur die Schokoladenfabrik, sondern baute parallel dazu einen Lebensmittelhandel auf. Unter dem Namen „Union“ betrieb er beispielsweise eine Filiale auf der Kölner Hohe Straße. Bei uns zu Hause gab es zwar einen Kühlschrank. Ich hatte bis dahin aber noch keine Kühlräume kennengelernt, in denen Gabelstapler verkehren. Ich war dann auch die Tage danach in seinem Bungalow oben auf den Moselhöhen und habe mit seinen Kindern gespielt, die jünger waren als ich. Der Bub hat dann später die vom Vater erworbene Schokoladenfabrik Hildebrand in Berlin geleitet.
Onkel Hans hatte damals schon einen hohen Bekanntheitsgrad in unserer noch jungen Republik. Die BILD-Zeitung berichtete wiederholt über ihn, Deutschlands jüngsten Nachkriegsmillionär, mitunter sogar auf der Titelseite. So auch über seine Reise in die Vereinigten Staaten, in einer Wirtschaftsdelegation mit Ludwig Ehrhard, Deutschlands legendärem Wirtschaftsminister und Verkörperung unseres Wirtschaftswunders.
Großmutter wusste Einiges zu erzählen, wie es zu seinem Aufstieg kam. Als Folge eines Augenleidens, erblich vorbelastet, wurde er 1943 als Soldat ausgemustert, war mithin zu Hause, als andere noch im Krieg oder anschließend in Gefangenschaft waren. Geschäftstüchtig, wie er war, nutzte er die Zeit, wo es an allem mangelte, für Geschäfte. Schon Mitte 1948 gründete er seine Schokoladenfabrik in Bullay mit einer auf dem Schwarzmarkt erstandenen Maschine.
Trotz seiner Geschäftstüchtigkeit gelang es ihm aber nicht, den Namen Imhoff als Marke zu etablieren. Er machte aus der Not eine Tugend und verkaufte seine Produkte unter Handelsnamen seiner Großabnehmer. Sein Ziel, Inhaber einer großen Marke zu werden, verlor er aber nicht aus dem Auge. Der erste große Coup gelang ihm 1972, als er von der Deutschen Bank 46 % der Anteile an der Kölner Stollwerk AG übernahm, die sich in einer Unternehmenskrise befand. Viele Berichte über ihn finden Sie bei Google, wenn sie dort seinen Namen eingeben, einen umfangreichen Artikel der Internetenzyklopädie WIKIPEDIA ebenso Zeitungs- und Zeitschriften-Artikel.
Da ich Köln 1969 verließ, um selbst Karriere zu machen, habe ich Hans Imhoff aus dem Auge verloren. So habe ich erst bei Niederschrift dieser Zeilen den Suchergebnissen von Google entnommen, wie viele namhafte Unternehmen der Schokoladenbranche er im Laufe der Zeit aufgekauft hat, dass das von ihm gegründete Schokoladenmuseum in Köln zu den meistbesuchten Museen Deutschlands zählt, er Ehrenbürger von Köln und Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes geworden ist und er zu den hundert reichsten Deutschen gehört hat. 2007 ist er gestorben, nachdem er alles verkauft und eine Familienstiftung gegründet hatte, die heute von einer seiner Töchter geleitet wird.
Ich fand es opportunistisch von meiner Großmutter, mich in jungen Jahren immer wieder zu bedrängen, doch Onkel Hans zu schreiben, wie stolz ich auf ihn sei, wenn mal wieder etwas über ihn in der Zeitung stand. Dann schickte er nämlich stets ein Schokoladenpaket, von dem Oma natürlich etwas abbekam. Ebenso opportunistisch fand ich es von meinem Vater, den Namen von Hans Imhoff als einen der trauernden Hinterbliebenen mit auf die Todesanzeige meiner Mutter zu schreiben, obwohl ich mich nicht an einen engen Kontakt zu ihm erinnern kann. So etwas geschieht halt leider, wenn jemand prominent ist.
Wie Phönix aus der Asche
Eindrücke aus der Nachkriegszeit
Gemessen am Grad der Zerstörung waren die Hauptverkehrsstraßen meiner Heimatstadt Köln schon relativ früh nach dem Krieg vom Schutt befreit. So konnten wir von unserem Vorort Holweide aus schon relativ früh mit der Straßenbahn in die Innenstadt fahren, vorbei an einem Meer von Ruinen. Das erste Großereignis, dem zuliebe wir die Innenstadt erreichen wollten, war die 700 Jahrfeier des Kölner Doms im August 1948. Wir, das waren meine Großmutter mütterlicherseits und ich.
Als zwei von tausenden Zaungästen erlebten wir eine feierliche Prozession hoher kirchlicher Würdenträger aus dem In- und Ausland durch die Ruinen der zerstörten Stadt, allen voran Kardinal Micara als päpstlicher Botschafter. Auch Konrad Adenauer, unser späterer erster Bundeskanzler, nahm daran teil. Heutzutage, wo Glauben und Kirche immer mehr an Bedeutung verlieren, kann man sich schwer vorstellen, wie jene Großveranstaltung den Überlebenden des Zweiten Weltkriegs wieder Hoffnung gab, wieder Perspektiven eröffnete. Politische Strukturen es ja damals noch nicht. Die etablierten sich erst im Laufe des folgenden Jahres.
Trotz zahlreicher Bombentreffer hatte der Kölner Dom den Krieg relativ gut überstanden. Der größte Schaden war ein Bombentreffer an der Nordwest-Ecke des Nordturms. Das große entstandene Loch wurde schnellstens mit Ziegelsteinen verfüllt, um einen Einsturz zu verhindern. Die so genannte Domplombe war noch lange nach dem Krieg zu sehen. Auf unserem Gymnasium hieß es später, dass sich unser Schulleiter Dr. Paul Börger, im Krieg Befehlshaber einer bei Köln stationierten Pioniereinheit, Major und Ritterkreuzträger, um die schnelle Verfüllung des Bombenschadens verdient gemacht und damit den Einsturz des Nordturms verhindert habe. Bei Niederschrift dieser Zeilen habe ich versucht, dies zu verifizieren. Zeitzeugen widersprechen sich aber in der Bewertung seines Beitrags. Er war aber unzweifelhaft einer der Leute, die sich um den Erhalt des Domturms verdient gemacht haben. Soweit ich mich erinnern kann, war der Innenraum des Kölner Doms noch viele Jahre nach dem Krieg nicht wasserdicht, ebenso wie der benachbarte Kölner Hauptbahnhof.
Wenn ich mich recht erinnere, war es in den großen Ferien des Jahres 1952, als ich von Köln aus ohne verwandtschaftliche Begleitung mit der Eisenbahn nach Lechbruck im Allgäu fuhr. Auf der Alm betrieben dort zwei Schwestern aus Schlesien ein Erholungsheim für Kinder. Davon erfuhr meine Großmutter bei ihrem eigenen Urlaub in Lechbruck und sorgte dafür, dass ich dort hinkam. Die Fahrt begann gegen 23 Uhr am Abend, derweil es wie gesagt durch das beschädigte Dach des Hauptbahnhofs hindurch regnete, und endete am späten Nachmittag des nächsten Tages. Ich erinnere mich nicht nur an die sich ständig wiederholenden Geräusche, wenn die Räder der Waggons über die Stoßstellen zwischen zwei Gleissträngen rollten, sondern auch an die Fahrt des Zuges im Schritttempo über die nur provisorisch ohne Geländer wieder hergestellte Eisenbahnbrücke über die Donau bei Ulm.
Das Erholungsheim für Kinder war letztlich eine Holzbaracke und das Essen nach heutigen Maßstäben spartanisch. Fleisch gab es so gut wie gar nicht, stattdessen Gurken, Tomaten, selbst gesammelte Pilze in jeder Form und Grießbrei auf schlesische Art, mit Zucker und Zimt bestreut und mit Milch übergossen. Gelegentlich essen wir ihn heute noch so.
In diesem Erholungsheim für Kinder lernte ich auch Sigrid kennen, die Tochter des damaligen Direktors vom Flughafen Köln-Bonn, Prof. Dr.-Ing. Heinrich Steinmann. Sie war zwei Jahre älter als ich und blitzgescheit, wie sich im Laufe der Zeit zunehmend herausstellte. Zu einer Zeit, wo wir schon lange keinen Kontakt mehr hatten, las ich ab und zu ihren Namen in der Zeitung. Ihr und dem dadurch zustande gekommenen Kennenlernen ihrer Eltern ist es zu verdanken, dass ich den schrittweisen Übergang vom britischen Militärflughafen zum Regierungsflughafen Köln-Bonn mitbekam. Wie Sigrid mir erzählte, war der damalige Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm ihr Onkel und selbst Konrad Adenauer soll schon mal bei ihnen zu Gast gewesen sein.
Ich war hautnah dabei, als unsere siegreiche Fußball-Nationalmannschaft 1954 von der Weltmeisterschaft in Bern zurückkehrte und ergatterte ein Autogramm von Ottmar Walter, Bruder des legendären Spielführers Fritz Walter. Auch wenn ich nie ein Fußballfan war, so begriff ich doch dieses Ereignis als einen Meilenstein in der Wiedererlangung internationaler Anerkennung Deutschlands nach dem Krieg. Noch deutlicher wurde mir das 1957, als auf dem Köln-Bonner Flughafen die Teilnehmer an der ersten NATO-Tagung in Bonn-Bad Godesberg eintrafen, nachdem die Bundesrepublik NATO-Mitglied geworden war. Bei einer Einladung, die ich mal von Sigrids Eltern bekam, beeindruckte mich der Briefbogen mit beiden Elternteilen im Briefkopf – zur damaligen Zeit keinesfalls selbstverständlich. Ich fand das im Sinne der Gleichberechtigung als sehr fortschrittlich und ahmte das in meiner eigenen Ehe sofort nach. Heute trägt der Flughafen Köln-Bonn den Namen unseres ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer und als Anschrift der Flughafengesellschaft den Namen von Sigrids Vater: Heinrich-Steinmann-Str. 12.
Der Name unseres ersten Bundeskanzlers war immer eng mit meiner Heimatstadt Köln verbunden. Konrad Adenauer konnte und wollte seinen rheinischen Zungenschlag nie verbergen. Zahlreiche Anekdoten werden authentisch nur mit diesem Zungenschlag wiedergegeben. Hinzu kommen die vielen Anekdoten über Adenauers Nähe zur katholischen Kirche. Adenauer war von 1917 – 1933 Oberbürgermeister von Köln, bis ihn die Nationalsozialisten seines Amtes enthoben. Zumal er schon die Jahre davor in Konflikt mit den Nationalsozialisten geraten war, war er den Alliierten nach dem Krieg bzgl. etwaiger NS-Vergangenheit über jeden Zweifel erhaben. Nicht nur Adenauer selbst, sondern auch unsere neue Bundesrepublik hatten engen Bezug zu Köln, da das damalige Bonn als Bundeshauptstadt zu klein, zu provinziell war. So hatten auch mehrere Botschaften und Generalkonsulate ihren Sitz im benachbarten Köln. Außer einer Autobahn waren Köln und Bonn auch durch eine eigene Eisenbahn miteinander verbunden.
Adenauers engen Kontakt zu Köln, zur katholischen Kirche und zum damaligen Erzbischof von Köln, Josef Kardinal Frings, legten es nahe, dass die Trauerfeier nach Adenauers Tod am 25. April 1967 von dem alten und inzwischen fast erblindeten Oberhirten im Kölner Dom abgehalten wurde. „Wir trauern um ihn wie um einen Vater“, zitiert ihn der SPIEGEL in seinem Rückblick 50 Jahre danach.
Gerade 16 Jahre alt geworden, erlebte ich als Zuschauer den Trauerzug vom Rheinufer zum Kölner Dom. US-Präsident Johnson, Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle, der britische Premierminister Harold Wilson, der israelische Ministerpräsident Ben Gurion, Regierungschefs, Außenminister und Botschafter aus weit über 100 Ländern der Welt erwiesen ihm die letzte Ehre. Wenn ich mich recht erinnere, nahmen auch der Schah von Persien, Kaiser Haile Selassie von Äthiopien sowie viele Würdenträger aus Afrika in bunten Gewändern teil. Soviel Prominente waren bis dahin und auch danach nie mehr zusammengekommen, trotz der heutigen Gipfeltreffen G7 und G20.
Auch wenn Anschläge, wie wir sie heute kennen, damals noch nicht üblich waren, so war doch damals schon der Sicherheitsaufwand groß. Es erzeugte auch bei mir als einem der vielen Zuschauer ein mulmiges Gefühl in der Magengrube, auf den Zinnen des Kölner Doms etliche Scharfschützen mit Maschinengewehren zu erblicken. Was wäre gewesen, wenn sich in meiner Nähe ein Zuschauer auffällig benommen hätte? Die Trauerfeier war auch das größte Medienspektakel aller Zeiten: Sie wurde sogar Live im Fernsehen in die USA und nach Japan übertragen mit schätzungsweise 400 Mio. Zuschauern.
Als ein Schnellboot der Bundesmarine mit dem Sarg Adenauers unter Begleitung weiterer Schiffe in Richtung Röhndorf ablegte, überflog eine Fliegerstaffel aus 12 Starfightern den Trauerkonvoi in niedriger Höhe und Feldhaubitzen feuerten 91 Schuss Salut.
Inzwischen war der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Kurt Georg Kiesinger der erste Bundeskanzler einer großen Koalition und Willy Brandt sein Außenminister. Mit dem Tod von Konrad Adenauer ist für mich aber der erste und meines Erachtens wichtigste Abschnitt des Nachkriegsdeutschlands, der Bonner Republik, zu Ende gegangen.
David gegen Goliath
Dramaturgie eines Machtkampfs
Wie Sie vielleicht schon von meiner Seite „Politik“ her wissen, war ich von 1993 – 1997 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, wurde im November 1994 als Nachfolger von Gründer Markus Wegner Fraktionsvorsitzender von STATT Partei und war nach Verlust des Fraktionsstatus wegen Unterschreitung der Mindestgröße nur noch Sprecher der verbliebenen fünf Abgeordneten. Zwischen der führenden SPD und STATT Partei gab es einen Kooperationsvertrag für die 15. Legislaturperiode, bei dessen Umsetzung es aber, wie so oft in der Politik, mitunter kräftig knirschte.
Besonders heftig knirschte es beim Thema „Verwaltungsreform“. Dazu hatte Jahre zuvor eine Enquetekommission unter Vorsitz von Prof. Hoffmann-Riem Vorschläge gemacht, für deren Umsetzung sich STATT Partei stark gemacht hatte. Die Zeichen dafür standen gut, weil wir inzwischen Prof. Hoffmann-Riem als Justizsenator gewinnen konnten und im Grunde genommen auch die SPD dafür war, mehr Macht an die Hamburger Bezirke abzugeben. Nicht jedoch Hamburgs Erster Bürgermeister Henning Voscherau sowie einige Senatoren, die im Wesentlichen den Istzustand beibehalten wollten. Nachdem der Senat nach kontroverser Diskussion zum zweiten Mal eine Entscheidung über die Bezirksverwaltungsreform vertagt hatte, kam es zum Eklat.
Am 01.04.1996 zitierte mich das Hamburger Abendblatt mit den Worten, es sei an der Zeit, das unwürdige Schauspiel zu beenden. Das Ende der Fahnenstange sei jetzt erreicht. Und BILD Hamburg zitierte mich am 03.04.1996 mit den Worten, Voscherau säge an seinem eigenen Ast. Die von uns geforderte Sitzung des Kooperationsausschusses könnte seine letzte sein. Tags drauf titelte das Hamburger Abendblatt „SPD und STATT: Der Ton wird immer schärfer“ und stellte im Innenteil Hamburgs Ersten Bürgermeister und mich mit großformatigen Fotos als Gegenspieler dar. Voscherau sei jetzt dünnhäutiger denn je, die Lage in der Regierungskooperation ernster als je zuvor. Derweil mache sich der Bürgermeister für eine Fusion zwischen Hamburg und seinen Nachbarländern stark.
Nach einer fünfstündigen Krisensitzung der Kooperationspartner schrieb das Hamburger Abendblatt am 12.04.1996, beiden Seiten sei die anschließende Beantwortung der Frage schwergefallen, welche konkreten Fortschritte denn nun erzielt worden seien. In ihrem Kommentar dazu schrieb Susanne von Bargen, die Bilanz der Sitzungsteilnehmer lasse nur einen Schluss zu: Die Gespräche hätten in Anwesenheit von Bürgermeister Voscherau stattgefunden, aber ohne seine Teilnahme. Und Uwe Bahnsen schrieb in der WELT, Reichert habe vor Mikrofonen und Fernsehkameras um jenes zarte Pflänzchen Hoffnung gebangt, das er in den sehr schwierigen Verhandlungen habe keimen sehen. Immerhin war aber vereinbart worden, dass Senator Mirow auf Seiten der SPD und Justizsenator Hoffmann-Riem auf STATT-Partei-Seite gemeinsam ein Papier erarbeiten, wie Ausnahmen vom Prinzip aussehen könnten, wenn die Verantwortung für Bauleitpläne in die Bezirke verlagert werde. Voscherau wollte sich nach Kenntnisnahme dieses Kompromisspapiers dann dass letzte Wort vorbehalten.
Die Hamburger CDU nutzte die schwelende Regierungskrise, um für die nächste aktuelle Stunde der Bürgerschaft als Thema anzumelden: „Das Schiff heißt Hamburg – doch was macht der Kapitän?“ Während die CDU selbst einen wenig markanten Beitrag lieferte, schlug mein Redebeitrag hohe Wellen. Aus meiner Rede hier einige Auszüge:
„Es gab einen Musikdampfer namens Hamburg; heute würde man das wohl Kreuzfahrtschiff nennen. Captain Henning I hatte unter Fahrensleuten ebenso wie bei Reedereien einen guten Namen, galt als klug und umsichtig, hatte schon viele Klippen umschifft. Auf Kohlenpötten hatte er angefangen und es dann über Containerfrachter in das feine Geschäft der Kreuzfahrtschiffe geschafft.
Hier fühlte er sich wohl, holte sich keine schmutzigen Hände mehr, glänzte als Salonlöwe und imponierte mit klugen Reden, die ihm bald den Ruf eines Visionärs einbrachten. Er kümmerte sich auch immer weniger um die Führung des Schiffes; dafür hatte er seine Offiziere. Erschien er mal auf der Brücke, dann mehr zum Händeschütteln und dem mehr allgemeinen Warnen vor den Gefahren der christlichen Seefahrt, als dass er sich über den Kurs des eigenen Schiffes informiert hätte…
Captain Henning war gerade mal wieder auf der Brücke, als Land in Sicht kam. Die Freude darüber … währte aber nicht lange, da Captain Henning die Seinen fürchterlich zusammenstauchte, wie sie dazu kämen, diesen Hafen anzulaufen … Zaghafte Rechtfertigungsversuche, dieses Reiseziel sei vereinbart gewesen, damit habe die Reederei geworben, dafür hätten die Passagiere bezahlt, halfen ihnen nicht vor den gestrengen Blicken des Herrn …“
Mehrere Zeitungen druckten meine Rede auszugsweise oder sogar vollständig, selbst BILD Hamburg. Nie zuvor habe ein Regierungspartner auf diese Weise öffentlich mit dem anderen abgerechnet, schrieb Susanne von Bargen am 20.04.1996 in ihrer Kolumne „Die Woche im Rathaus“ des Hamburger Abendblatts. Die Rede sei ein Hammer gewesen, zitierte BILD Hamburg am 19.04.1996 CDU-Fraktionschef Ole von Beust. So rechne man normalerweise nur kurz vor einer Scheidung miteinander ab. Mit seiner Analyse habe Reichert aber völlig recht. SPD-Fraktionsvize Jan Ehlers wollte meine Rede nicht überbewerten. Was die Wortwahl anbetreffe, sei man im Umgang miteinander ohnehin nicht mehr zimperlich. Und ein politisch Aktiver von vor meiner Zeit, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte, schrieb mir: „Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen zu Ihrer ausgezeichneten Rede vor der Bürgerschaft zu gratulieren. Die Art Ihres Vortrags erinnerte mich an eine ansonsten ausgestorbene Spezies: Den Florettfechter im Parlament.“
Auch wenn die Presse meine Rede vorwiegend kritisch bewertete und in die Nähe von Majestätsbeleidigung rückte: Als dramaturgischer Höhepunkt der seit Wochen schwelenden Regierungskrise hat sie ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie hat nach vorwiegender Meinung politischer Beobachter verdeutlicht, dass es STATT Partei mit der Umsetzung der im Kooperationsvertrag vereinbarten Verwaltungsreform bitterernst ist und sie zur Not auch vor einem Bruch des Bündnisses nicht zurückschrecken würde. Auf dem von den Genossen mit Sorge erwarteten Landesparteitag der Hamburger SPD gab Voscherau dann grünes Licht für die Bezirksverwaltungsreform auf Basis der von den Senatoren Mirow und Hoffmann-Riem erarbeiteten „Klarstellungen“. So kommentierte dann Veit Ruppersberg die Entwicklung am 22.04.1996 im Hamburger Abendblatt, rational sei das alles kaum mehr nachzuvollziehen. Habe es sich denn letztlich nur um politischen Theaterdonner gehandelt? Vielleicht habe Voscherau ja gespürt, wie wenig Verständnis sein Alleingang in der Öffentlichkeit und auch in seiner eigenen Partei gefunden habe. Denn für die SPD habe ein Platzen der Zusammenarbeit mit der STATT Partei fatale Folgen gehabt.
Bleibt noch dreierlei nachzutragen:
Zum einen, dass ich es ungleich schwerer gehabt hätte, mich durchzusetzen, wenn nicht auch große Teile der Hamburger SPD die Bezirksverwaltungsreform gewollt hätten und zugeben mussten, dass sie im Kooperationsvertrag auch vereinbart war.
Zum zweiten, dass meine „von Gehässigkeiten durchsetzte Rede“ (Zitat Hamburger Abendblatt 18.04.1996) das Verhältnis zwischen unserem Bürgermeister und mir nicht nachhaltig belastet hat, zumal BILD Hamburg auch wiedergegeben hat, was Voscherau – allerdings nicht öffentlich – schon über mich geäußert hat. Bereits zwei Monate nach der hier geschilderten Auseinandersetzung sagte Voscherau am 20.06.1996 in der Fernsehsendung „Schalthoff live“ des Fernsehsenders „Hamburg 1“, STATT Partei sei kein taktischer, kein machtbesessener, sondern ein sachbezogener Kooperationspartner. Und das sei in der Politik selten. Er glaube, dass sich die Hamburger Bürger noch einmal nach dieser versachlichenden Kraft zurücksehnen würden. Nach meiner Rede zur Verabschiedung des Hamburger Haushalts 1997 sagte er am 16. Dezember 1996 in der Hamburger Bürgerschaft: „Lieber Herr Reichert, wir wollen Sie behalten. Nach dieser schönen, lustigen Rede, die außerdem zur Sache war, wollen wir Sie behalten.“ Wir haben dann noch jahrelang in Briefkontakt gestanden.
Zum dritten, dass Voscherau trotz der von mir karikierten Eigenheiten in Hamburg sehr beliebt war, von der Wirtschaft und auch von der Presse sehr geschätzt wurde. Als Erster Bürgermeister des Stadtstaats Hamburg ist er vom Rang her gleichbedeutend den Ministerpräsidenten der Flächenländer. Wenn er auf Kongressen ein Grußwort hielt, war dies anschließend bei den Teilnehmern vielfach ein Gesprächsthema. Nicht zuletzt möchte ich daran erinnern, dass Bundeskanzlerin Merkel ihn der SPD mal als gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen hat, um in der Bundesversammlung eine breite Zustimmung zu sichern. Meiner Erinnerung nach stieß sie damit aber bei der SPD auf wenig Gegenliebe.
Die Versorgungslücke
Vorab zwei Sprüche von mir zum Thema, nachzulesen auf www.aphorismen.de:
„Je mehr du dir in jungen Jahren gönnst, desto mehr wird es dir im Alter fehlen.“
„Die Versorgungslücke im Alter entsteht durch zwei Fehleinschätzungen: Die Unterschätzung, wieviel man im Alter benötigt, und die Überschätzung, wieviel man bekommt.“
Wenn man jung ist, in Kraft und Saft steht, gut ausgebildet ist und das ganze Leben noch vor sich hat, dann denkt man nicht darüber nach, was einem alles passieren kann und für das es sich lohnen würde, vorzusorgen. Ohne eigenes Verschulden kann man beispielsweise selbst oder ein enger Familienangehöriger schwer erkranken oder verunglücken, aus betrieblichen Gründen kann man die berufliche Stellung verlieren und in fortgeschrittenem Alter keine neue mehr finden. Teils durch eigenes Verschulden, teils durch Änderung nicht beeinflussbarer Rahmenbedingungen, kann man sein Erspartes falsch anlegen und dabei viel Geld verlieren. Die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen kann die ganze bisherige Planung über den Haufen werfen, von den vielen Imponderabilien beruflicher Selbstständigkeit ganz zu schweigen.
In jungen Jahren möchte man schließlich was vom Leben haben. Wozu das ganze Geld, wenn man sich davon nichts leisten kann: Ein tolles Auto, ein eigenes Haus, erlebnisreiche Urlaube, ein kostspieliges Hobby. Die anderen machen es uns ja vor; warum zurückstehen?
Im Lebenshunger junger Jahre begeht man die im Zitat erwähnten Fehleinschätzungen, wieviel man im Alter benötigt und wieviel Altersbezüge man zu erwarten hat. Man unterstellt, dass man bis dahin ja alles hat: das eigene Auto, das eigene Haus, die komplette Wohnungseinrichtung und natürlich eine ausreichende Altersversorgung.
Als Lebensplanung für mich erstmals ein Thema wurde, lag das gesetzliche Rentenalter noch bei 65 Jahren. Wer es erreichte, hatte im Schnitt noch fünf Jahre zu leben. Jetzt wird zwar das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise bis auf 67 Jahre angehoben. Die danach noch verbleibende Lebenserwartung ist aber erheblich höher geworden. 80 Jahre alt zu werden, ist heute nichts besonderes mehr. Das Gros meiner früheren Klassenkameraden ist es bereits geworden. Früher kam der Bürgermeister dann persönlich zur Gratulation. Heutzutage wäre er damit hoffnungslos überfordert.
Je größer die Lebenserwartung, desto größer der Irrtum:
- Das Auto, das wir bei Eintritt in den Ruhestand haben, können wir nicht bis zum Tod fahren. Die Reparaturen werden immer teurer, schließlich lohnen sie sich nicht mehr. Ein neues Auto desselben Typs ist inzwischen aber wesentlich teurer als sein Vorgänger.
- Das eigene Haus braucht neue Fenster, irgendwann auch ein neues Dach und eine neue Heizung. Unabhängig von anderen Aspekten fordern das auch Gesetze zum Klimaschutz, die es in jungen Jahren noch gar nicht gab.
- Eine Couchgarnitur ist irgendwann verschlissen oder altmodisch, der Fernseher kaputt oder für moderne Übertragungstechniken nicht mehr geeignet, Computer und Smartphone werden angeschafft, die in jungen Jahren noch gar nicht erfunden waren.
- Mit zunehmendem Alter ist man aber auch auf Dinge angewiesen, an die man in jungen Jahren gar nicht denkt: Nahrungsergänzungsmittel und nicht verschreibungsfähige Medikamente und Behandlungen, Brillen, Zahnersatz, Hörgeräte, Rollator, elektrischen Behindertenfahrstuhl. Für Tätigkeiten, die man früher selbst erledigt hat, z.B. als Heimwerker, muss man jetzt Hilfen anderer Menschen in Anspruch nehmen. Und die kosten !
Andererseits haben die Altersbezüge unter mehreren Einflüssen gelitten. Beispielsweise:
- Reduzierung der staatlichen Rente durch die zunehmende Lebenserwartung der Bevölkerung
- Reduzierung betrieblicher Renten durch einen vom Betrieb forcierten vorgezogenen Ruhestand und betriebliche Insolvenzen
- Niedrig- oder Nullzinspolitik der Notenbank, d.h. keine Zinsen mehr für Erspartes und unrentabel gewordene Lebensversicherungen.
Aus Statistiken weiß ich, dass ich überdurchschnittlich viel Vorsorge betrieben habe. Mit Blick auf erlittene Schicksalsschläge muss ich aber zugeben, es war viel zu wenig: Beispielsweise wurde unser Sohn in jungen Jahren schwer krank und konnte nicht im üblichen Alter ins Erwerbsleben einsteigen. Obwohl beruflich sehr erfolgreich und geschätzt, verlor ich durch mehrfache betriebliche Umstrukturierungen zuerst meine Stellung, dann auch meine Anstellung, zusammen mit 16.000 anderen Mitarbeitern eines Großunternehmens, das schließlich ganze Werke stilllegte oder verkaufte. Vieles, für das meine Familie und ich Geld ausgegeben haben, wäre daran gemessen nicht notwendig gewesen.
Ich kann daher nur jedem jungen Menschen, der diese Zeilen liest, nur dringend raten, eine möglichst hohe Altersvorsorge zu betreiben.